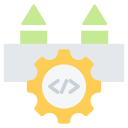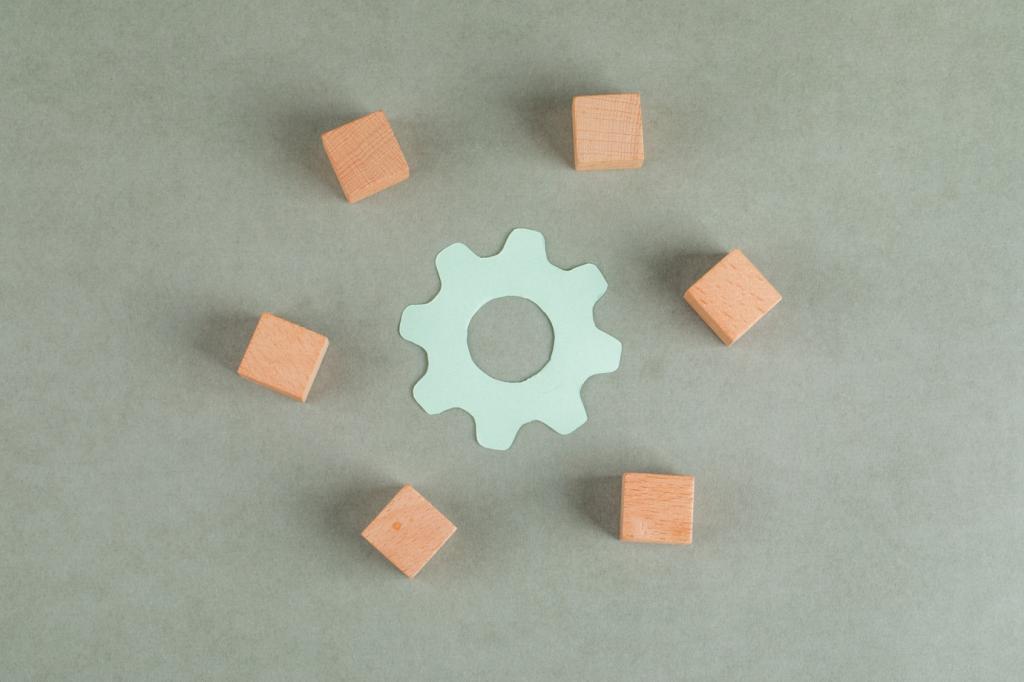Toolauswahl: Ein pragmatischer Entscheidungsrahmen
Bewerten Sie Integrationen, Sicherheit, Skalierung, Bedienbarkeit, Testbarkeit, Preis und Support. Low-Code sollte SDKs und CI/CD bieten. No-Code braucht starke Vorlagen und klare Datenmodelle. Stimmen Sie Kriterien mit IT und Fachbereich ab, damit beide Seiten gewinnen.
Toolauswahl: Ein pragmatischer Entscheidungsrahmen
Definieren Sie messbare Ziele, reale Daten und Zeitrahmen. Testen Sie einen kritischen Prozess, nicht nur eine Demo. Ziehen Sie früh Stakeholder hinzu. Dokumentieren Sie Architekturentscheidungen, damit der Übergang von Pilot zu Produktion reibungslos und nachvollziehbar gelingt.